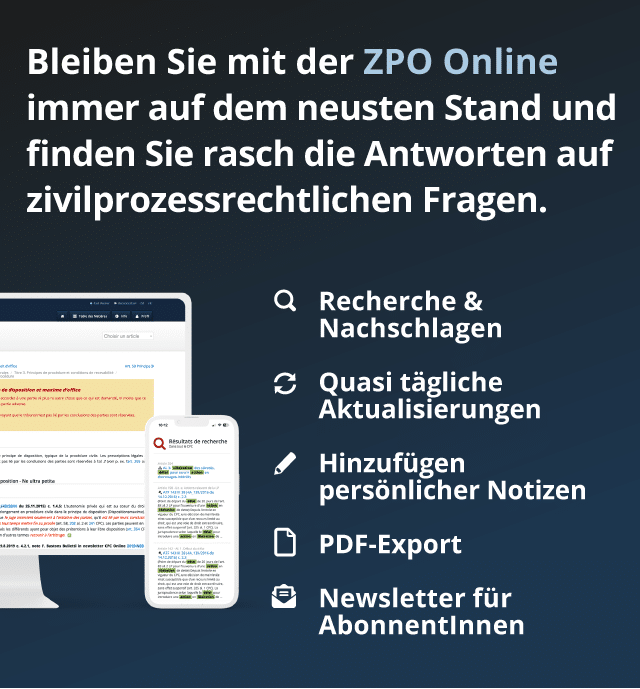Art. 81 Grundsätze
1 Die streitverkündende Partei kann Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegenüber der streitberufenen Person zu haben glaubt oder die sie von Seiten der streitberufenen Person befürchtet, beim Gericht, das mit der Hauptklage befasst ist, geltend machen, sofern:
1. die Ansprüche in einem sachlichen Zusammenhang mit der Hauptklage ste- hen;
2. das Gericht dafür sachlich zuständig ist; und
3. die Hauptklage und die Ansprüche im ordentlichen Verfahren zu beurteilen sind.
2 Die streitberufene Person kann keine weitere Streitverkündungsklage erheben.
3 Aufgehoben
Art. 81 Grundsätze
1 Die streitverkündende Partei kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptklage befasst ist, geltend machen.
2 Die streitberufene Person kann keine weitere Streitverkündungsklage erheben.
3 Im vereinfachten und im summarischen Verfahren ist die Streitverkündungsklage unzulässig.
Diese qualifizierte Streitverkündung ist eine Alternative zur gewöhnlichen Litisdenuntiatio. Die Drittperson wird nicht nur um Hilfe gerufen, vielmehr erhebt die betreffende Hauptpartei unmittelbar Klage gegen sie. Zu denken ist wiederum an den Verkäufer, der von einer geschädigten Käuferin auf Schadenersatz belangt wird: Er will der Herstellerin den Streit vielleicht nicht nur verkünden, sondern gegen sie sogleich Regressklage erheben. Diese Option gibt ihm die Streitverkündungsklage. Der Verkäufer kann die Herstellerin vor das Gericht ziehen, das bereits mit dem Schadenersatzprozess befasst ist. Aufgrund des Sachszusammenhangs ist dieses Gericht auch für die Regressklage örtlich und sachlich zuständig.
Die Streitverkündungsklage führt dazu, dass die Ansprüche verschiedener Beteiligter in einem einzigen Prozess – statt in sukzessiven Einzelverfahren – behandelt werden können. Ein solches «Gesamtverfahren» bietet viele Vorteile:
– Da die Streitverkündungsklage nicht nur am Ort des Hauptprozesses, sondern direkt beim befassten Gericht erhoben wird, werden widersprüchliche Urteile im Erst- und Folgeprozess vermieden. Den Parteien bleibt zudem ein möglicherweise aufwändiger Gerichtsstandwechsel erspart.
– Sodann werden Synergien genutzt: Die Aktenkenntnis des Gerichts kann in zwei Prozessen verwendet werden. Auch für die Beweiserhebung bieten sich Vorteile. Es ist beispielsweise möglich, einen Augenschein oder eine Zeugenbefragung am selben Gerichtstag gleichzeitig für beide Prozesse durchzuführen oder ein und dasselbe Sachverständigengutachten in beiden Prozessen zu verwenden.
Insgesamt kann sich dadurch eine namhafte Kosten- und Ressourcenersparnis für die Parteien und das Gericht ergeben. Trotzdem ist die Streitverkündungsklage nicht ganz unproblematisch: So zwingt sie die dritte Person je nachdem zur Prozessführung an einen «fremden» Gerichtsstand. Ausserdem hat sie für den hängigen Hauptprozess notwendigerweise Verzögerungen und Komplikationen zur Folge. Deshalb ist diese Verfahrensoption erstens nicht voraussetzungslos und zweitens nicht in allen Prozessarten zulässig.
Artikel 81 Absatz 1 nennt die Voraussetzungen der Streitverkündungsklage: Die Bestimmung verlangt – anders als noch der Vorentwurf – neben der gleichen sachlichen Zuständigkeit und der gleichen Verfahrensart zusätzlich die Konnexität von Haupt- und Folgeanspruch. Die Hauptfälle solcher Konnexität sind Regress- und Gew.hrleistungsansprüche zwischen einer Partei und der dritten Person. Die streitberufene Partei kann ihrerseits keine weitere Streitverkündungsklage erheben (Art. 81 Abs. 2). Damit wird der Kettenappell und eine zu grosse Komplizierung und Verzögerung der Verfahren vermieden. Meist ist somit ein anderes Gericht an einem anderen Ort für die weitere Klage der Drittperson zuständig. Doch
könnte selbst in diesem Fall eine Überweisung an das Gericht des Hauptprozesses stattfinden, um dem Sachzusammenhang Rechnung zu tragen (Art. 127). Die Prozesse hingegen würden grundsätzlich getrennt geführt. Anders als noch der Vernehmlassungsentwurf schliesst der Entwurf die Streitverkündungsklage im vereinfachten und summarischen Verfahren ausdrücklich aus (Art. 81 Abs. 3). Sie würde dem Wesen dieser Verfahren zu sehr widersprechen, weil sie zwangsläufig zu einer gewissen Komplikation und Verlängerung des Prozesses führt. Das Arbeitsfeld der Streitverkündungsklage ist somit auf das ordentliche Verfahren und die Handelsgerichtsbarkeit beschränkt.
S. 2714 f.: Sodann schlägt der Bundesrat vor, die Regelung der Streitverkündungsklage in Artikel 81 E-ZPO neu und klarer zu fassen, damit dieses mit der ZPO neu schweizweit geschaffene Institut attraktiver wird. Auch weiterhin soll erforderlich sein, dass Haupt- und Streitverkündungsklage im ordentlichen Verfahren zu beurteilen sind (Art. 81 Abs. 1 Bst. c E-ZPO); dazu soll insbesondere auch festgehalten werden, dass die Streitverkündungsklage nicht zu beziffern ist, wenn sie auf Leistung dessen geht, wozu die streitverkündende Partei ihrerseits im Hauptverfahren verpflichtet wird (vgl. Art. 82 Abs. 1 dritter Satz E-ZPO und dessen Erläuterungen). Forderungen in der Vernehmlassung (Bericht Vernehmlassung, Ziff. 5.9) nach einer Abschaffung dieses Instruments sind nach Ansicht des Bundesrates nicht gerechtfertigt.
S. 2735 f.:
Mit der ZPO wurde die Streitverkündungsklage schweizweit als neues Institut eingeführt, nachdem sie vorher nur in den Kantonen Genf, Waadt und Wallis sowie teilweise im Kanton Tessin bekannt war. Die Streitverkündungsklage ermöglicht es über die einfache Streitverkündung (vgl. Art. 78 ff. ZPO) hinaus, unmittelbar im Rahmen der Hauptklage einen Entscheid über die Ansprüche der streitverkündenden Partei gegenüber der streitberufenen Person zu erwirken (Vgl. Botschaft ZPO, BBl 2006 7283 ff.).
In der Praxis hat sich gezeigt, dass dieses prozessuale Instrument bisher noch wenig oder kaum genutzt wird. Nach Ansicht des Bundesrates ist es daher wichtig, die Funktionsfähigkeit der Streitverkündungsklage im Schweizer Recht zu verbessern (vgl. die Erläuterungen zu Art. 82 Abs. 1 Satz 3). Nach dem Vorschlag des Bundesrates soll daher die Regelung über die Voraussetzungen und Zulässigkeit der Streitverkündungsklage in Artikel 81 Absatz 1 ZPO klarer gefasst werden. Dazu soll der Gehalt der bisherigen Absätze 1 und 3 in einem neuen Absatz 1 zusammengefasst und um die sich bisher aus Lehre und Rechtsprechung ergebenden Voraussetzungen ergänzt und in einer Aufzählung klar strukturiert werden:
– Im Ingress soll neu zum Ausdruck gebracht werden, dass die Streitverkündungsklage zur Geltendmachung von Ansprüchen zur Verfügung steht, welche die streitverkündende Partei im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt oder die sie von Seiten der streitberufenen Person befürchtet; damit soll sich neu auch der Fall der Streitverkündungsklage als negative Feststellungsklage klar aus dem Gesetzeswortlaut ergeben (vgl. dazu Nina J. Frei, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, Diss. Zürich 2004, S. 114 f.).
– In einem Buchstaben a soll neu die bereits nach geltendem Recht bestehende (vgl. Botschaft ZPO, BBl 20067284 f.; BGE 139III 67 E. 2.4.3 sowie Tarkan Göksu, Art. 81 N 9, in: DIKE ZPO, 2. Aufl., Zürich 2016) Voraussetzung der Konnexität gesetzlich festgehalten werden, wie dies auch im Vorentwurf zur ZPO vorgesehen war. Es wird auch deutlich, dass neben den Fällen der (potenziellen) Regressansprüche durchaus auch andere Fälle von Gewährleistungs- und Schadloshaltungsansprüchen denkbar sind.
– Buchstabe b bringt zum Ausdruck, dass für Haupt- und Streitverkündungsklage die gleiche sachliche Zuständigkeit gegeben sein muss. Auch diese Voraussetzung des geltenden Rechts (BGE 139III 67 E. 2.4.3) soll sich neu unmittelbar aus dem Gesetz ergeben; materiell ist damit keine Rechtsänderung verbunden.
– In einem Buchstaben c soll neu die verfahrensmässige Zulässigkeit geregelt werden, die bisher in Absatz 3 geregelt ist. Im Unterschied zum geltenden Recht soll klargestellt werden, dass die Streitverkündungsklage ausschliesslich im ordentlichen Verfahren zulässig ist; wie nach geltendem Recht ausgeschlossen ist sie daher im vereinfachten und im summarischen Verfahren, weil diese Verfahren nicht dergestalt kompliziert und verlängert werden sollen (vgl. dazu bereits Botschaft ZPO, BBl 20067285). Wie im geltenden Recht (BGE 139III 67 E. 2.4.2; vgl. auch Daniel Schwander, Art. 81 N 26 ff., in: ZK ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016), jedoch im Unterschied zum Vorentwurf, wird sowohl für die Hauptklage als auch für die Streitverkündungsklage das ordentliche Verfahren verlangt; damit trägt der Bundesrat den diesbezüglich kritischen Stellungnahmen in der Vernehmlassung Rechnung (Bericht Vernehmlassung, Ziff. 5.9 ).
Der bisherige Absatz 2 wird unverändert übernommen; wie bisher sind sogenannte Kettenstreitverkündungsklagen zur Vermeidung einer übermässigen Komplizierung und Verzögerung des Verfahrens ausgeschlossen. Der bisherige Absatz 3 geht inhaltlich im neu gefassten Absatz 1 auf und kann somit aufgehoben werden, ohne dass sich damit die Rechtslage ändert.