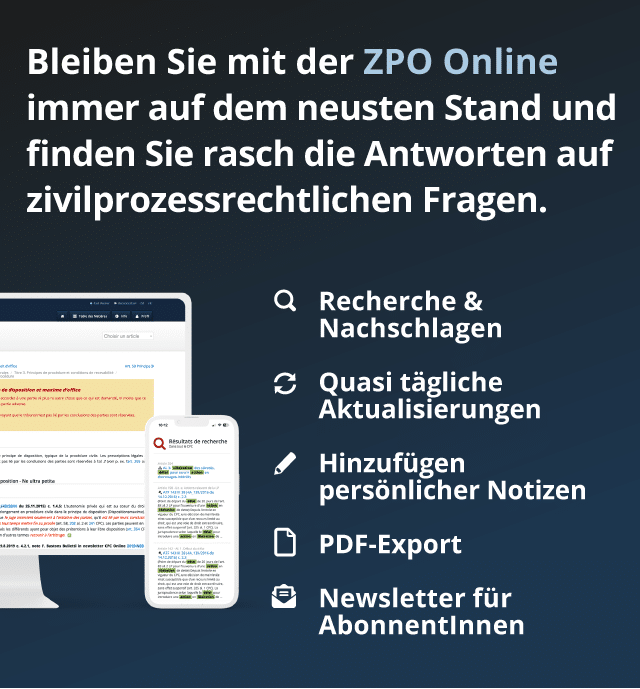Art. 129
1 Das Verfahren wird in der Amtssprache des zuständigen Kantons geführt. Bei mehreren Amtssprachen regeln die Kantone den Gebrauch der Sprachen.
2 Das kantonale Recht kann vorsehen, dass auf Antrag sämtlicher Parteien folgende Sprachen benutzt werden:
a. eine andere Landessprache, wobei keine Partei auf die Verfahrenssprache nach Absatz 1 zum Voraus verzichten kann;
b. die englische Sprache in internationalen handelsrechtlichen Streitigkeiten nach Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe c vor dem Handelsgericht oder dem ordentlichen Gericht.
Art. 129
Das Verfahren wird in der Amtssprache des zuständigen Kantons geführt. Bei mehreren Amtssprachen regeln die Kantone den Gebrauch der Sprachen.
Der Gebrauch einer Amtssprache des Kantons ist die Regel (Abs. 1). Andere Sprachen – z.B. Englisch – sind jedoch nicht ausgeschlossen, sofern die Parteien und das Gericht damit einverstanden sind (Abs. 2).
S. 2718 : [...] zukünftig [sollen] grundsätzlich auch Verfahren in englischer Sprache sowie in Landessprachen, die am Gerichtsort nicht Amtssprache sind, möglich werden (Art. 129 Abs. 2 E-ZPO sowie der Entwurf zu Art. 42 Abs. 1bis des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG]).
S. 2745 ff.: Art. 129 Abs. 2
Artikel 129 ZPO regelt die Verfahrenssprache: Nach dieser Bestimmung werden Verfahren in der Amtssprache des zuständigen Kantons geführt, wobei die Kantone gegebenenfalls den Gebrauch bei mehreren Amtssprachen regeln. Diese Regelung hat sich seit Inkrafttreten der ZPO bewährt. Gleichzeitig hat sich dieses Regime in einem Punkt als zu restriktiv erwiesen: Indem für die Verfahrenssprache in Zivilverfahren direkt an die kantonalen Amtssprachen angeknüpft wird, wird den Kantonen faktisch untersagt, die Verwendung anderer Sprachen als die Amtssprachen zu erlauben (Vgl. auch Entscheid 400 18 41 des Kantonsgerichts Basel-Landschaft (KGer BL) vom 9. Oktober 2018, E. 5.5). Auch weil sich die Kantone bei der Bestimmung der Amtssprache selbstverständlich an die Grundsätze gemäss Artikel 70 Absatz 2 BV zu halten haben, ist diese Regelung in zweierlei Hinsicht unbefriedigend: Zum einen schliesst dies die Möglichkeit der Verwendung anderer Landessprachen aus, soweit es sich nicht auch um die Amtssprache im betreffenden Kanton handelt, was insbesondere auch an den Sprach- und Landesgrenzen heute sehr restriktiv erscheinen mag. Zum andern schliesst es aber auch die Möglichkeit der Verwendung der englischen Sprache in kantonalen Verfahren aus, was heute auch zu restriktiv und insbesondere für bestimmte Wirtschaftsbereiche wirklichkeitsfremd erscheint. Dies schränkt die Kantone insbesondere dort ein, wo derzeit Bestrebungen und Initiativen zur besseren und aktiveren Positionierung der Schweiz als Justizplatz für internationale Zivil- und Handelssachen laufen, welchen der Bundesrat positiv gegenübersteht (vgl. Ziff. 4.1.6): Weil solche internationalen Verfahren überwiegend in Englisch, allenfalls auch in Französisch geführt werden, ist es für den Erfolg solcher Initiativen essentiell, dass Zivilverfahren auch in einer anderen Sprache als einer kantonalen Amtssprache geführt werden können, und zwar in gewissem Masse unter Einschluss allfälliger Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesgericht (vgl. Ziff. 5.2.1), wie die vergleichbaren Initiativen im Ausland deutlich machen (Vgl. Die entsprechenden Neuerungen in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland, wo Englisch als Verfahrenssprache solcher Verfahren im Zentrum stand (siehe Ziff. 3 und 4.1.6 vorne m.w.H.).). Entsprechend wurde in der Vernehmlassung eine Ergänzung von Artikel 129 ZPO gewünscht (Bericht Vernehmlassung, Ziff. 6.1).
Der Bundesrat schlägt daher die Ergänzung von Artikel 129 ZPO um einen neuen Absatz 2 vor: Nach dieser Bestimmung erhalten die Kantone von Bundesrechts wegen ausdrücklich die Kompetenz, in ihrem Recht den Gebrauch einer anderen Landessprache des Bundes oder der englischen Sprache als Verfahrenssprache vorzusehen, wenn sämtliche Parteien einen entsprechenden Antrag stellen. Ob die Kantone generell oder im Rahmen erwähnter Bestrebungen für besondere Verfahren für grosse internationale Streitfälle von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch machen, ist damit den einzelnen Kantonen überlassen, in deren Organisations- und Sprachenautonomie nicht eingegriffen wird. Gestützt auf diese Kompetenz sollen die Kantone in ihren jeweiligen Gesetzen zur Gerichts- und ergänzenden Verfahrensorganisation neben den Amtssprachen weitere Verfahrenssprachen zulassen können, wobei diese von Bundesrechts wegen immer nur auf Antrag sämtlicher an einem Verfahren beteiligten Parteien zur Anwendung kommen können. Nach Ansicht des Bundesrates ist es sinnvoll, diesen Entscheid seitens Bund dem kantonalen Gesetzgeber zu übertragen und nicht direkt den jeweiligen Gerichten und Parteien zu überlassen, wie dies bei der Schaffung der ZPO diskutiert, vom Parlament aber abgelehnt wurde. Demgegenüber lehnt es der Bundesrat jedoch ab, im Bundesrecht die Zulassung der Verwendung sämtlicher Amtssprachen des Bundes für Rechtsschriften in Zivil- und Strafverfahren vor kantonalen Behörden vorzusehen (vgl. Motion 18.4358 Candinas «Sprachenregelung für Eingaben in kantonalen Verfahren».). Zum Schutz der Parteien darf aber die Verwendung einer anderen Sprache als einer kantonalen Amtssprache stets nur auf Antrag sämtlicher Parteien erfolgen. Gerade in internationalen Zivil- und Handelssachen, welche zukünftig nach Massgabe einer besonderen Vereinbarung der Parteien vor ein internationales Handelsgericht gebracht werden, werden die Parteien damit ohne weiteres einverstanden sein beziehungsweise die Verwendung der englischen Sprache als Verfahrenssprache bereits in ihrer Gerichtsstandsvereinbarung im Voraus verbindlich vereinbart haben, was grundsätzlich als entsprechender Antrag zu betrachten ist. Darüber hinaus ist es den Kantonen respektive Gerichten ohne weiteres möglich, auf Kosten der Parteien eine Übersetzung von Entscheiden vorzusehen beziehungsweise zu erstellen, wie das teilweise im Ausland ausdrücklich vorgesehen ist (Vgl. z.B. für die Chambre internationale du tribunal de commerce de Paris und die Cour d’appel de Paris oder die Kammer für internationale Handelssachen des Landgerichts Frankfurt (vgl. dazu Ziff. 3)). Unverändert stets in einer Amtssprache zu führen sind die Verfahren vor dem Bundesgericht, so dass insbesondere auch bundesgerichtliche Entscheide stets in einer Amtssprache erfolgen (vgl. auch Ziff. 5.2.1).
S. 2778 f.: Art. 42 Abs. 1bis BGG
Artikel 42 regelt die Rechtsschriften in Verfahren vor dem Bundesgericht. Grundsätzlich müssen diese in einer Amtssprache des Bundes abgefasst werden (Abs. 1). Soweit mit der vorgeschlagenen Neuerung von Artikel 129 Absatz 2 E-ZPO das vorinstanzliche Verfahren zukünftig auf Antrag sämtlicher Parteien auch in englischer Sprache geführt werden kann, wenn dies das kantonale Recht so vorsieht (vgl. dazu auch Ziff. 4.1.6 sowie die Erläuterungen zu Art. 129 E-ZPO), erscheint diese Regelung zu einschränkend: Wenn das Verfahren vor der kantonalen Vorinstanz zukünftig allenfalls in englischer Sprache geführt wurde, so sollen die Parteien auch in einem anschliessenden Verfahren vor dem Bundesgericht ihre Rechtsschriften in englischer Sprache abfassen können (Abs. 1bis). Unverändert nach den allgemeinen Regelungen von Artikel 54 BGG richtet sich die Verfahrenssprache und damit auch die Sprache der Entscheide im bundesgerichtlichen Verfahren: Diese ergehen auch zukünftig stets in einer Amtssprache. Damit wird für die Parteien die Möglichkeit der Verwendung der englischen Sprache, aber auch anderer als der kantonalen Amtssprachen (vgl. Art. 129 Abs. 2 E-ZPO), instanzenübergreifend bis zum Bundesgericht umgesetzt. Die vorgeschlagene Regelung entspricht inhaltlich dem Vorschlag des Bundesrates für die Schiedsgerichtsbarkeit, der derzeit im Parlament diskutiert wird (Art. 77 Abs. 2bis E-BGG in der Fassung E-IPRG) (18.076 Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht. 12. Kapitel: Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Botschaft und Entwurf vom 24. Oktober 2018 zur Änderung des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (12. Kapitel: Internationale Schiedsgerichtsbarkeit), BBl 2018 7163 ff.; am 18. Oktober 2019 ist die RK-N dem Vorschlag des Bundesrates gefolgt, vgl. Medienmitteilung RK-N vom 18. Oktober 2019, abrufbar unter www.parlament.ch > Organe > Kommissionen > Sachbereichskommissionen > RK > Medienmitteilungen).
S. 2780: Die Vorlage hat in verschiedener Hinsicht Auswirkungen auf die Kantone: [...] Mit den vorgeschlagenen Anpassungen betreffend die Möglichkeit der Schaffung besonderer internationaler Handelsgerichte (vgl. Ziff. 4.1.6 sowie insb. Art. 6 Abs. 4 Bst. c und Art. 129 Abs. 2 E-ZPO) erhalten die Kantone zudem die Möglichkeit (nicht aber die Pflicht) für weitere Anpassungen in ihrer Gerichts- und Behördenorganisation, sofern sie hier Handlungsbedarf sehen.
Änderungen des Textes im Verlauf der parlamentarischen Beratungen: Vgl. AB 2021 S 676 ff.; AB 2022 N 678, 682 ff., 691; AB 2022 S 644 ff.; AB 2022 N 2256 f., 2259 f.; AB 2023 S 8; AB 2023 N 216 und 218.